Grundsätze:
Challenge by Choice (Freiwilligkeit)
Bei unseren erlebnispädagogischen Angeboten geht es immer darum, die Teilnehmenden aus ihren Komfortzonen und Alltagsstrukturen herauszuholen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Neues zu erleben, Erfahrung zu machen und zu daraus lernen. Dabei ist es uns jedoch besonders wichtig, die individuellen Grenzen jedes Einzelnen zu respektieren und niemanden im Rahmen unserer Herausforderungen zu überfordern. Denn sobald ein Mensch in den Bereich der Überforderung gerät, setzt der Verstand aus, es entsteht Panik und ein nachhaltiges Lernen ist nicht mehr möglich.
Deshalb versuchen wir stets auf die individuellen Bedürfnisse unserer Teilnehmer:innen einzugehen, sie zu ermutigen sich auf die Herausforderungen einzulassen ohne sie dabei zu drängen und möglicherweise zu überfordern.


Handlungsorientiertes Lernen
Das didaktisch-methodische Konzept der Erlebnispädagogik lässt sich im Bereich des handlungsorientierten Lernens verorten. Dabei ist das Ziel durch das gezielte Setzen verschiedener Lernstimuli neben den kognitiven auch die emotional-affektive sowie die psychomotorischen Ebene der Teilnehmer*innen zu aktivieren. („Kopf-Herz-Hand“) In der Erlebnispädagogik geschieht diese Erweiterung des Lernhorizonts einerseits durch die Wahl der Umgebung (Setting), den herausfordernden Charakter der erlebnispädagogischen Aktionen und Übungen, die das aktive Handeln der Teilnehmenden erfordern und natürlich durch die professionelle Begleitung und Reflexion des Lernprozesses durch den Erlebnispädagogen. Auf diese Weise werden die jeweiligen thematischen Inhalte der Lernsituation auf vielschichtige Weise in der Erinnerung der Teilnehmenden verankert und eine ganzheitliche Lernerfahrung ermöglicht.
Man kann einem Menschen nichts beibringen, man kann ihm nur helfen,
G. Galilei
es in sich selbst zu entdecken.
Was ist eigentlich Erlebnispädagogik?
Seit nunmehr einigen Dekaden wird der Begriff Erlebnispädagogik von vielen unterschiedlichen Menschen und Institutionen verwendet um bestimmte handlungsorientierte pädagogische Ansätze zu beschreiben. Dabei ging es meist in irgendeiner Form um (natur-)sportliche Aktivitäten deren Zweck jedoch über die rein sportliche Betätigung hinaus gehen sollte. Weil jedoch lange keine Einigkeit über die genau Definition herrschte und die Berufsbezeichnung „Erlebnispädagoge“ auch nicht geschützt ist, war oft nicht eindeutig was genau sich hinter entsprechenden Angeboten verbarg.
Um diesen Missstand zu beheben wurde bis zum Jahr 2015 vom ‚Hochschulforum Erlebnispädagogik‘ und dem Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. in einem mehrjährigen Prozess das Berufsbild des Erlebnispädagogen entwickelt und verabschiedet und wird seitdem kontinuierlich weiterentwickelt:


Berufsbild Erlebnispädagog:in
Das Berufsbild wurde vom ‚Hochschulforum Erlebnispädagogik‘ und dem Bundesverband Individual-und Erlebnispädagogik e.V. (Fachgruppe „Aus- und Weiterbildung“) in einem dreijährigen Prozess entwickelt und am 13.03.2015 erstmals verabschiedet.
Aufgaben und Tätigkeiten
Die spezifischen Aufgaben und Tätigkeiten von Erlebnispädagog:innen liegen in der zielgerichteten, fachlich fundierten Planung und Durchführung handlungsorientierter Lernszenarien für Einzelpersonen und Gruppen, vorzugsweise in und mit der Natur als Erfahrungsraum. Sie arrangieren ganzheitlich orientierte, individuell herausfordernde und nicht alltägliche Situationen, die entwicklungs- und bildungswirksame Erlebnisse ermöglichen. Diese fördern vorrangig personale, soziale und emotionale Kompetenzen. Ergänzend können je nach Lernraum undAktivität technisch-instrumentelle Fertigkeiten und Kenntnisse erlernt und gestärkt werden. Dafür nutzen Erlebnispädagog:innen überwiegend das Gruppensetting als Katalysator.
Bei der Planung, Durchführung und Evaluierung der Lernszenarien berücksichtigen Erlebnispädagog:innen grundlegende Strukturmerkmale wie beispielsweise Selbststeuerung, Eigenverantwortung, Freiwilligkeit, Ressourcen- und Prozessorientierung sowie die Dimension der sozialen Interaktion. Erlebnispädagog:innen gestalten Lernprozesse im realen Raum mit physischer Präsenz. Die Möglichkeiten von digitalen Begegnungs- und Lernformaten können ergänzend genutzt werden.
Neben der Beachtung aktueller Qualitäts- und Sicherheitsstandards stehen die physische, psychische und soziale Unversehrtheit der Teilnehmenden im Vordergrund. Im Sinne einer nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung wird Wert auf einen achtsamen, klimaschonenden Umgang mit der Natur und Umwelt gelegt.
Um einen Lerntransfer und Entwicklungsprozesse in die Lebens- und Arbeitswelt zu unterstützen, setzen Erlebnispädagog:innen verschiedene Reflexionsmethoden ein. Sie arbeiten theoriegeleitet und greifen dabei auf spezifische Lern- und Wirkungsmodelle zurück.
Lernräume und Aktivitäten
Charakteristische Angebote reichen von natursportlichen Aktivitäten wie zum Beispiel Wandertouren, Segeln, Klettern, Kanufahren über Wildnis- und Naturaufenthalte bis zu Interaktionsübungen und handlungsorientierten Projekten. Solozeiten, kreativ-rituelle Angebote oder City Bound gehören zum weiteren Spektrum.
Arbeits- und Handlungsfelder
Erlebnispädagog:innen sind im Bereich ‚Pädagogik’ zum Beispiel in der Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendhilfe, im schulischen, außerschulischen und tertiären Bildungsbereich oder in der Erwachsenenbildung und Heilpädagogik tätig.
Im Bereich ‚Wirtschaft’ arbeiten Erlebnispädagog:innen vorzugsweise als Prozessbegleiter:innen und Trainer:innen im Rahmen von Personal- und Organisationsentwicklung.
Auf dem Gebiet der ‚Gesundheitsförderung’ sind Erlebnispädagog:innen vor allem in der Prävention und Rehabilitation tätig.
Im Handlungsfeld der ‚Therapie’ unterstützen Erlebnispädagog:innen als Teil eines multiprofessionellen Teams therapeutische Prozesse¹.
Ein erweitertes Arbeitsfeld finden Erlebnispädagog:innen im Bereich der Natur- und Umweltbildung sowie in der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Sie sind ferner in freizeitpädagogischen und touristischen Bereichen tätig, arbeiten dort aber vorwiegend erlebnisorientiert.


Kompetenzen und Ausbildung
Erlebnispädagog:innen erwerben im Rahmen ihrer Ausbildung neben pädagogischen und psychologischen Kompetenzen zur angemessenen Prozessbegleitung und verantwortungsvollen Gruppenführung auch die erforderlichen technisch-instrumentellen Kompetenzen zur sicheren Anleitung der Teilnehmenden in den entsprechenden erlebnispädagogischen Lernräumen und Aktivitäten.
Grundlegend sind hierbei die Orientierung an einem humanistischen Menschenbild, eine wertschätzende Haltung gegenüber menschlicher Vielfalt und einem Wertesystem, das sich in den Menschenrechten verankert sieht. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und sie professionell und bewusst einsetzen zu können, sind fachliche, personale und soziale Kompetenzen notwendig. Diese erlangen sie durch eine qualifizierte pädagogische Ausbildung sowie eine fundierte erlebnispädagogische Qualifizierung, wie sie der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. formuliert hat. Darüber hinaus ist eine für die spezifischen Aktivitäten und Lernräume entsprechende (fachsportliche) Qualifikation erforderlich.
Bearbeitungsstand: 29. März 2023
Was bedeutet systemisches Denken?
Die Systemtheorie begreift die gesamte Welt als eine unendliche Zahl von miteinander interagierenden, ineinander verwobenen und sich wechselseitig aufeinander beziehenden Systemen. So bildet jedes Lebewesen, vom Mikroorganismus bis hin zu hochentwickelten Säugetieren, sein eigenes System, welches in eine bestimmte Umgebung eingebettet ist, die wiederum eine Vielzahl anderer Systeme (Familie, Klasse, Ökosystem) bildet und aus diesen besteht. Dabei zeigt jedes dieser Systeme eine grundlegende Eigenschaft, welche es zu einer eigenen Entität und einem in sich funktionierenden System, werden lassen: die Autopoiesie (gr. Selbsterschaffung, Selbsterhaltung).
Jedes lebende System funktioniert für sich und in sich zirkulär, das bedeutet es erschafft und erhält sich in einem dauerhaften Prozess kontinuierlich selbst. Ein beliebtes Beispiel hierfür aus dem Bereich der Kybernetik ist ein Kühlschrank: Die Temperatur im inneren des Kühlschranks wirdpermanent von einem Thermometer gemessen. Steigt nun die Temperatur des Raumes in welchem sich der Kühlschrank befindet, steigt mit der Zeit auch die Temperatur im Inneren des Kühlschrankes selbst. Sobald diese über einen vorher definierten Wert steigt, bemerkt das der Temperaturfühler und aktiviert das Kühlaggregat um Temperatur im Inneren Kühlschranks zu senken. Sobald die vordefinierte Temperatur wieder erreicht ist, wird die neue Situation durch das Thermometer registriert und das Aggregat wird abgeschaltet. Der Kreislauf ist geschlossen.
Auf eine vergleichbare Weise, wenngleich erheblich komplexer, funktioniert auch jedes lebende System. Ein Missstand im System, welcher die Systemerhaltung gefährden könnte (z.B. Hunger) wird erkannt und die zum Fortbestand des Systems erforderlichen Maßnahmen (Essen) werden getroffen. Sobald die Gefährdung gebannt ist (Sättigung) werden die Maßnahmen (Essen) beendet. Die Systemerhaltung ist gelungen, der Kreislauf geschlossen.
Doch da wir grundsätzlich nicht in der Lage sind in andere Menschen hineinzuschauen und zu sehen, was diese Person denkt und fühlt, was sie erlebt hat und was sie bewegt, bleiben uns die genauen Abläufe dieses uns fremden Systems meist Verschlossen. So bildet und konstruiert jeder Mensch, jedes Lebewesen sein eigenes System und seine eigeneWirklichkeit deren Funktionsweise nur er selbst in Gänze verstehen kann. Zugleich ist jedoch auch jedes System eingebettet in eine äußere Umgebung die aus verschiedensten anderen Systemen und Einflüssen besteht und mit der es interagiert.
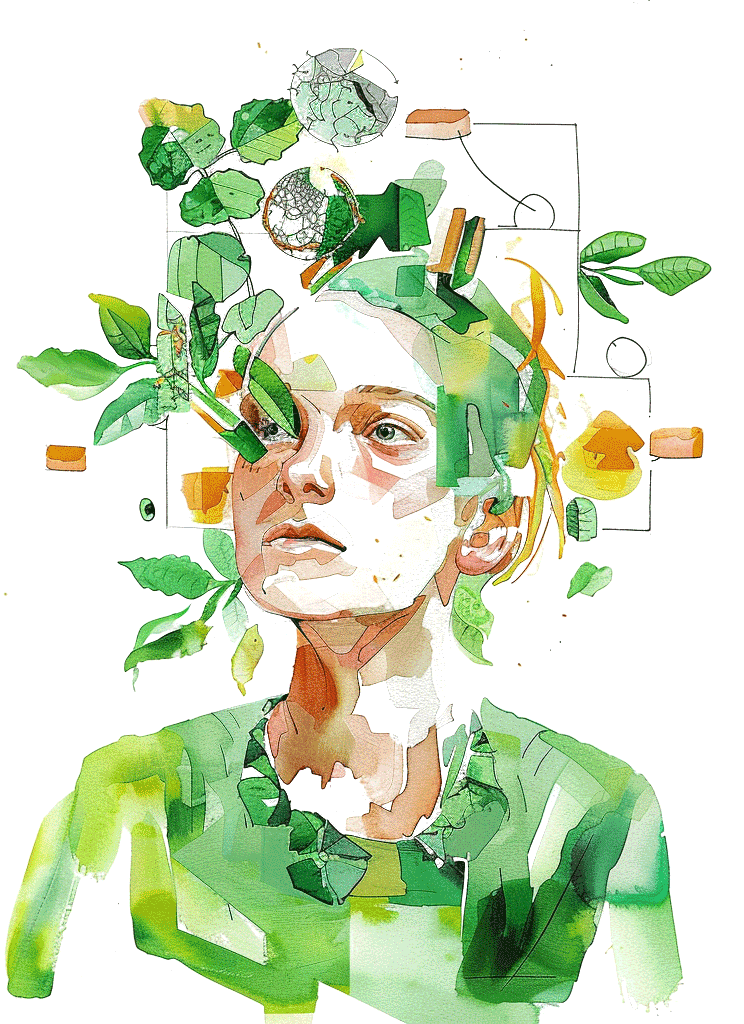
Was hat das mit Erlebnispädagogik zu tun?
Da wir nicht in der Lage sind in andere Menschen (Systeme) hineinzusehen, um zu ergründen welche Prozesse genau in ihnen ablaufen und wie ihre Wirklichkeit gestaltet ist, bleibt uns nur zu beobachten, wie sie auf verschiedene Einflüsse und Veränderungen ihrer Umgebung (Perturbationen) reagieren. Denn in seinem autopoietischen Strebenist jedes System permanent
gefordert sich an veränderte Bedingungen seiner Umgebung anzupassen, sich weiterzuentwickeln um sich selbst zu erhalten.
Für die Erlebnispädagogik bedeutet das, dass wir nicht davon ausgehen können, dass wir mit Übung A bei den Teilnehmenden Reaktion B auslösen um diese damit zu Erkenntnis C zu bringen. Jeder Mensch hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht, andere Gedanken- und Erklärungsmuster entwickelt, sich eine eigene Wirklichkeit erschaffen und reagiert dementsprechend unterschiedlich auf veränderte Umweltbedingungen. Es ist somit das Ziel der Erlebnispädagogik ein Setting zu schaffen in dem durch spezifische Interventionen (Übungen, Aktionen) das (Denk-und Handlungs-)System ihrer Adressat*innen auf eine Weise herausgefordert wird, die eine Veränderung der bestehenden Muster erforderlich macht, um somit eine Weiterentwicklung zu befördern, ohne die Teilnehmenden dabei zu überfordern.
Die Paradoxie dabei ist, dass wir im Vorhinein nicht wissen können, welche Anpassungsprozesse wir durch unser Handeln bei den Adressat:innen auslösen. Aus diesem Grund ist es nötig diese Prozesse sehr achtsam zu verfolgen, gegebenenfalls durch kurze Interventionen nachzusteuern wo dies erforderlich ist und mit professioneller Neugier zu gemeinsam zu reflektieren wohin diese geführt haben.
